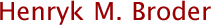Sie haben das Recht zu schweigen. Henryk M. Broders Sparring-Arena
03.01.2005 12:02 +Feedback
Ingo Langner: Kultus, Thalia und das große Vergessen
Einige Anmerkungen zum Zustand der deutschen theatralischen Anstalten am Beispiel Berlin.
»O schrecklich! Den Menschen ein Graunanblick! O schrecklicher war nichts andres, soviel Ich zuvor antraf!«
Sophokles, König Ödipus.
Ist die Heilige Messe auch eine Art von Theater? Wer so fragt, muß kein Atheist, Protestant oder Häretikern sein. Der feierliche Einzug, die farbenprächtigen Gewänder, das Kommen und Gehen am Altar, die Kerzen, der Weihrauch und vielleicht sogar noch Latein und gregorianischer Gesang. Ein römisch-katholisches Hochamt spricht alle Sinn an, und - soll es das nicht?
Zwischen Theater und Kultus besteht ganz offenbar eine Verwandtschaft. Doch anders als beim Ei und der Henne läßt sich die Frage, was zuerst da war, in diesem Fall leicht beantworten. Denn daß dem Gottesdienst hier das Erstgeburtsrecht gebührt, steht für Historiker fest. Aus dem Ruf des Priesters und der Antwort der Gläubigen hat sich im antiken griechischen Theater das Hin und Her zwischen Vorsänger und Chor entwickelt. Als dann einer vom Chor die Rolle des primus inter pares kreierte, war der Dialog erfunden. Was folgte, war lediglich die Ausfaltung eines tragfähigen Prinzips. Denn aus Dialog und Chor läßt sich jede Tragödie formen, wie Aischylos, Sophokles oder Euripides mit ihren unsterblichen Werken beweisen konnten.
Zu ihrer Zeit war das Tragödienspielen Teil des Kultus. Das zur Anschauung gebrachte Schicksal verwies auf das Band, welches Mensch und Gott nach antikem Denken miteinander verbindet. Der Schicksalsschrecken, und jede Tragödie lief unweigerlich darauf hinaus, sollte zur Katharsis, mithin zur Erschütterung führen. War dann der Zuschauer durch den Schock geläutert, bot ihm das auf die drei obligatorischen Tragödien folgende Satyrspiel einen lustvoll heiteren Ausklang - das weinende und lachende Doppelgesicht der Commedia hat hier seinen Ursprung.
Aus dem Kult also, dem Dienst an den Göttern, entstand das Theater, und weil es von den Griechen einst lernte, daß heiter und ernst zusammengehören, gibt es sich bis heute die größte Mühe, uns immer aufs Neue beide Seite der Menschennatur zu zeigen.
Über zweieinhalbtausend Jahre Theatergeschichte sind eine lange Zeit. Der Mensch ist ein kreatives Wesen, und gerade im Spiel treibt seine Schöpferkraft die erstaunlichsten Blüten. Daß in diesem Prozeß auch zweifelhafte Pflanzen zum Licht streben, scheint dabei nur natürlich zu sein. Schon bei Euripides zeigen sich inhaltlich und formal erste Anzeichen von Dekadenz. Am Ende des klassischen Altertums zogen die Beliebtesten unter den griechischen Schauspielern mit einem Repertoire aus zugkräftigen Monologen von Amphitheater zu Amphitheater. Nicht mehr die gottgewollte Katharsis kam beim Publikum an, sondern ein Unterhaltungsprogramm, zusammengestellt aus einer Liste der besten Nummern. Auch damals also schon Abstiege.
Bekanntlich übernahmen die Römer das Beste der Griechen. Gleich nach den Punischen Kriegen läßt man den zu Ehren Jupiters stattfindenden sportlichen Wettkämpfen, den Ludi Romani, dramatische Darbietungen folgen. Die Geburt der römischen Tragödie, sozusagen auf dem Verordnungswege beschlossen, ist mit dem Jahr 240 v. Chr. exakt zu datieren. Was ein wenig spröde begann, erreichte mit Vergil den höchsten Gipfel. In seiner »Aeneis« gab er den Römern das, was Homer den Griechen gegeben hatte: einen Mythos. Ohne Vergils Dichtung kein »Roma aeterna«, und wenn sich Dante in seiner »Göttlichen Komödie« von Vergil bis an die Schwelle des Paradiso geleiten läßt, dann überbrückt er dichtend nicht nur mehr als 1200 Jahre, sondern öffnet auch ein Fenster zur Ewigkeit.
Am Anfang des geistlichen Dramas im Mittelalter steht das liturgische Drama. Diese Bezeichnung verweist auf den Ursprung dieser Spiele im gottesdienstlichen Kultus der römisch-katholischen Kirche. In den Osterspielen des Mittelalters lebte die antike Tradition fort, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Das Alte und Neue Testament geizt mit lebensprallen Geschichten wahrlich nicht. Daraus ließen sich Stoffe in Hülle und Fülle entwickeln. Feinsinnige Theatertruppen durften ihre Kunst in der Osterzeit sogar innerhalb der Kathedralen zeigen - wurden sie derb oder frech oder aufmüpfig oder alles zugleich, mußten sie die Gotteshäuser verlassen. Es läßt sich leicht denken, daß ihre Vertreibung Reklame genug war, um im Rücken der Kirche die sensationslüsternen Massen anzuziehen.
William Shakespeare schuf aus den Elementen der klassischen Tragödien, den Satyr- und Mysterienspielen große moderne Dramen. Wie seine Vorgänger, verwob er Menschenschicksale in ihrem Spannungsgeflecht zwischen Gott, Politik und irdischer Liebe zu einer überzeitlichen Wahrheit. Shakespeare hat den ewigen Konflikt in der Brust des Menschen verlegt. Bei ihm sprechen nicht mehr die Seher, sondern die Narren Wahres. Besonnene Weisheit, Vergebung, Mitleid und Reinheit vermögen die Welt zu erlösen. Das unterscheidet ihn von den Tragödien Hellas. Ob dem Stratforder oder den Griechen der Platz auf dem obersten Treppchen in der Aula ewigen Ruhms zusteht, ist eine Frage, die Federfuchser entscheiden mögen. Wir sehen jene und ihn und Vergil Arm in Arm die Himmelsbühne bespielen.
Als sich nun, Dank der Renommiersucht der deutschen Fürstenhöfe, in unseren Gauen eine veritable Theaterkultur entwickeln konnte - wir zehren noch heute davon! - wußte die auf der Klaviatur des Überlieferten immer besser zu spielen. Thalias Gabentisch war nach nunmehr 2000 Jahren reich gedeckt, und das deutsche bürgerliche Theater legt mit Lessing, Schiller, Goethe, Hebbel, Büchner und Kleist noch einige Schwergewichte dazu.
Auch die Darstellungskunst selbst trat schließlich nicht mehr auf der Stelle. Nach der lange üblichen Deklamation zwischen Spielbein und Standbein möglichst weit vorn an der Rampe, begannen die Schauspieler sich zu erinnern, daß ihren Körpern von der Natur auch noch einige andere Ausdrucksformen in die Wiege gelegt worden waren. Das Theater geriet im Wortsinne in Bewegung, und geprägt von einer bewundernswerten Dichte an schreibenden und spielenden Meistern kam es zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin zu sich selbst.
»Das Deutsche Theater ist unter Max Reinhardt mit dem ‘Käthchen von HeilbronnO (Kleist) eröffnet worden. Der Feuilletonist pflegt in solchen Fällen das Wort OMarksteinO hinzulegen«, lobte der große Alfred Kerr 1907, und gute sechzig Jahre später attestierte der unvergeßliche Friedrich Luft »Selten sah man so entfesseltes Theater, eine so üppige Schaulust sich entfalten - und erhält zugleich soviel Intelligenz, Moral und Nutzanwendung mühelos vermittelt.«. Luft besprach so 1971 Peter Steins Inszenierung von Ibsens »Peer Gynt«.
Doch all das ist nicht mehr. Peter Zadek hat sich mit seiner vor einem Jahr gezeigten Interpretation von Brechts »Mutter Courage« von einer der neun Musentöchter des Zeus und der Mnemosyne einen weiteren Lorbeer auf sein schon oft bekränztes Haupt legen lassen. Luc Bondy war kürzlich mit einem Gastspiel aus England hier. Da blitzte wieder einmal sein großes Können auf.
Was aber sonst? Gewiß, hier und da, gibt es gute Gründe zufrieden die Spielstätten der Hauptstadt zu verlassen. Aber der alte Glanz ist passé. Nur in Wien oder in München leuchtet ab und an noch ein Stern ganz hell auf. Mit ein wenig Glück wird so ein Leuchten dann auch zum alljährlichen Berliner Theatertreffen eingeladen. Falls es die Kritikerjury nicht vorzieht, »programmatisch« zu sein und uns das sogenannte Junge, Innovative, Dynamische, Aufgeklärte, Tabulose, kurz: das Zeitgeistige präsentiert. Wenn das geschieht, dann muß man mit der Geduld eines Opferlammes gesegnet sein, um nicht laut schreiend den Zuschauerraum vorzeitig zu verlassen.
Im Zeitgeistigen wird alles Elend des heutigen Theaters offenbar. Seine Kennzeichen sind: 1. mangelnde Sprechkultur (man nuschelt und lispelt), 2. Gymnastik statt motivierter Artistik (wälzen, rennen, hüpfen, springen), 3. verwackelte und unscharfe Videoeinspielungen und 4. (und das ist das Schlimmste) stückemordende Regisseure. Diese Spezies hat sich einem Virus gleich in allen Theatern deutscher Zunge ausgebreitet und betrachtet die großen Dramen der Weltliteratur als Steinbruch aus dem man sich nach Belieben bedienen kann. Was ausgerechnet dieses parasitäre und ausbeuterische Verfahren mit der behaupteten »Gesellschaftskritik« zu tun haben soll, wird uns ewig ein Rätsel bleiben.
Die wahren Motive liegen offensichtlich woanders. Denn dieses Theater beweist:
- das Ego des Regisseurs ist das Wichtigste,
- alles was dieses kindisch-ichbezogene Motiv in Frage stellen könnte wird so lange plattgewalzt, bis es in die kleinbürgerliche Schablone des Spielleiters paßt,
- wenn es für diese klitzekleine Schachtel immer noch zu sperrig ist, wird es gestrichen. Diese Methode nennt sich radikal.
Das ist sie auch. Aber es ist die Radikalität rasender Spießer, die nicht bemerken, daß ihr Selbstverständnis mit Kunst nichts mehr gemein hat. In ihren Zurichtungen haust die Eliminierungswut des Totalitären. Deren Furor hat sich auch in der jakobinischen Guillotine selbstverwirklicht. Sie ist ein Grundzug jener Moderne, die sich nur allzu gerne die Maske der allgemeinen Wohlfahrt und des Fortschritts aufsetzt. Wir haben sie satt.
In einer solchen Sphäre allgemeiner Bewußtlosigkeit haben die Tiefen und Höhen der Weltdramatik keinen Raum mehr. Die blutigen Qualen des König Ödipus werden in Ketchup ertränkt. Gretchens Gebet zur schmerzensreichen Madonna ist ein Slapstick aus Stottern und Stöhnen, und Rosalind oder Kriemhild oder Lady Macbeth sind geistlose Zicken - dem Nachmittagsprogramm privater Fernsehsender entsprungen. Wer da noch das Wahre, Gute oder gar Schöne begehrt, der wünscht etwas, was die heute tonangebende Generation der Theatermacher nicht geben will und - schlimmer noch - uns nicht mehr zu geben vermag. Die eigenen Kreaturen sind ihnen wichtiger als der gebotene Respekt vor den Geschöpfen der Dichter. Aus narzißtischer Attitüde ist längst selbstverschuldete Unmündigkeit geworden.
Schlimm ist auch, daß eine parallel zu diesem Treiben agierende Schar von mehr oder weniger jungen Theaterkritikern in diesem qualitätsverschlingenden Malstrom Wegweisendes sehen möchte. Sie schreiben Quark hoch, um dadurch selbst aufzusteigen. So sind die von Kerr bis Luft gültigen Maßstäbe und der kritische Abstand allmählich einer Melange aus Klüngel und Gesinnungskitsch gewichen. Nur in wenigen Feuilletons noch hält man dagegen. Die Mehrheit sitzt auf der Rutschbahn nach unten und redet wie maulflotte Marktweiber die Mängel der Ware schön.
In diesem Haus aus Schaum und Seifenblasen die Frage zu stellen, wie man es denn mit der Religion halte, muß dann zwangsläufig zu einem Schlag ins Wasser werden. Zwar möchte das eine oder andere Berliner Theater beim Zusammenprall der Kulturen nicht ohne die hochgezogene Flagge der sich kritisch gebenden Toleranz dastehen. Talkshows zum Islam liegen bekanntlich im Trend. Was der Koran ist oder sein könnte oder besser noch: sein müßte, wird gerne auch auf Theaterpodien diskutiert. Aber die Bibel ist ausgerechnet bei denen zu einem Buch mit sieben Siegeln geworden, deren Bibliotheken ohne die Texte von der Genesis bis zur Apokalypse fast leer wären. Denn welches Buch aus dem jüdisch-christlichen Kulturkreis ist nicht vom Alten und Neuen Testament beeinflußt.
Dabei wird die Volksbibel seit einigen Wochen für 10 Euro an jedem Kiosk verkauft, und nach der Bhagwan- und Buddhamode outen sich Prominente neuerdings im Fernsehen als Christen und zeigen ohne Scheu ihr Kreuz im Dekolleté. Haben die Theater hier etwas verpaßt? Denn wer bei den Berliner Bühnen in einer Weihnachtsumfrage um eine Stellungnahme zum Apostolischen Glaubensbekenntnis bittet, bleibt ohne Antwort. Allein das Pressebüro des Berliner Ensembles teilt mit, keinen Antwortgeber gefunden zu haben. Die Bitte dieser Zeitung an alle Theatermacher Berlins, sich vor dem Hintergrund der aktuellen Debatten über Religion und die Grundlagen unserer europäischen Kultur, zu einem Glaubensbekenntnis zu äußern, daß weltweit von mehr als einer Milliarde römisch-katholischer Christen gebetet wird, scheint man für die bizarre Idee eines Diasporakatholiken zu halten, die gänzlich ohne Bedeutung ist.
Wer gegenüber dem christlichen Glaubenbekenntnis sprachlos geworden ist, muß sich fragen lassen, ob ihm die uralten Verbindungslinien zwischen Kultus und Kultur auch nichts mehr sagen. Doch aus welchen Quellen schöpft man dann? Wegen der üblich gewordenen Theaterverrichtungen können es nur flache und trübe Brackwasser sein.
Weil wir ohne Antwort geblieben sind, haben wir den Versuch unternommen, uns in das Seelenleben der Intendanten Claus Peymann (Berliner Ensemble), Frank Castorf (Volksbühne) und Thomas Ostermeier (Schaubühne) einzufühlen. Wir möchten unseren Lesern die Gemütslage wenigstens dieser drei namhaften Berliner Theatermacher ein wenig näher bringen. Ein selbstverfaßtes Dramolett ist das Ergebnis dieser virtuellen Psychoanalyse. Wir drucken es hier im Folgenden ab, geben aber gleichzeitig unserer Hoffnung Ausdruck, daß die Sohle des tiefen Tals nunmehr erreicht ist. Irgendwann muß es doch wieder aufwärts gehen - und wer weiß, vielleicht klopft eine neue Generation von Schauspielern und Regisseuren die sich nicht mit der Wiederkehr des immer gleichen Gebräus aus der Hexenküche der Kulturklitterer abfinden wollen, schon im neuen Jahr laut und vernehmlich an die Pforten der deutschen Bühnen.
Dramolett
Frank Castorf, Claus Peymann und Thomas Ostermeier wollen gemeinsam Weihnachten feiern und dann doch lieber nicht.
Die Szene: am Ufer der Spree.
Peymann Schaut euch das an. Jetzt ist alles neu hier: der Fußweg, die ganze Uferpromenade. Die Regierungsneubauten. Alles neu. Nur der Humboldthafen da drüben sieht immer noch aus wie Osten.
Castorf Das ist auch der Osten, Peymann.
Peymann Ja! Wir schauen nach Osten! So wie ich immer nach Osten geschaut habe. Mein Leben lang. Das ist mein linker Blick. Schon damals, als ich in Stuttgart für die Ensslin und die RAF Geld für deren Zahnersatz gesammelt habe, da war ich links, da hab ich immer nach Osten geschaut. Naturgemäß. Immer nach Osten. Immer der linke Blick.
Ostermeier Wie war das eigentlich mit diesen Rafzähnen genau, Herr Peymann?
Castorf Das will doch heute keiner mehr wissen. Da hing doch bloß ein kleiner Zettel am schwarzen Brett und Peymann hat 100 Mark gegeben. Er ist mit 100 Mark zum Mythos geworden.
Peymann Das muß mir erst einmal einer nachmachen, Castorf! Du mußtest Dir deinen Mythos doch hart erarbeiten. Bei dir guckt der Schweiß und der Kartoffelsalat aus allen Mythosecken, und dann stellst du noch dieses OST-Schild auf das Dach der Volksbühne. Ist doch lächerlich.
Ostermeier Was soll am Osten denn lächerlich sei, Herr Peymann?
Peymann Alles. Am Osten ist naturgemäß alles lächerlich. Aber am lächerlichsten bist du, Castorf. Du und dein Kartoffelsalat, ihr seid das Lächerlichste im lächerlichen Osten.
Castorf Am Lächerlichsten im Osten sind deine Inszenierungen am BE, Peymann. Wenn du Brecht inszenierst, ist das Totenschändung.
Ostermeier Frieden, liebe Kollegen. Frieden! Ich dachte wir sind hier, weil wir gemeinsam Weihnachten feiern wollen. Wir wollen ein Zeichen setzen. Zu Weihnachten. Jetzt wo alles im Konsum versunken ist, wo der Kapitalismus wieder Triumphe feiert. Da setzen wir unsere Botschaft dagegen: die drei größten Berliner Theatermacher feiern gemeinsam Weihnachten. Das zeigt: wir handeln! Wir sind gemeinsam gegen den Kapitalismus, gegen den Konsum, gegen die Oberflächlichkeit, gegen den ganzen Schwund.
Castorf Was fürn Schwund denn? Ist doch alles Schwund. Auch Weihnachten ist schwund. Heiner Müller hat nie Weihnachten gefeiert.
Peymann Eben. Deswegen wollen wir doch gemeinsam feiern. Wir müssen da etwas tun, Castorf. Wir müssen wieder anders in die Schlagzeilen kommen. Nicht immer nur weil man uns die Subventionen kürzen will. Da hört doch keiner mehr hin.
Castorf Da ist was dran, Peymann. Aber wozu feiert man Weihnachten eigentlich? Was ist das Wahre am Weihnachtsfest? Was ist überhaupt Wahrheit? Das fragte schon dieser Pilatus den Jesus. Ich hab das in meinem Bulgakow1 groß gebracht. Jesus weiß, der Pilatus der hat Kopfschmerzen. Das sagt er ihm mitten ins Gesicht, so Face to Face. Dazu dann dröhnende Musik aus den Boxen. Kopfschmerzen, das ist deine Wahrheit. Sagt dieser Jesus, diesem Pilatus, diesem Oberrömer. Und ich hab auch Kopfschmerzen. Ich krieg Kopfschmerzen hier draußen im Wind. Das ist meine Wahrheit, Peymann.
Ostermeier Weihnachten ist doch auch das Fest der Familie. Wir an der Schaubühne interessieren uns auch für die Familie. Wir machen Stücke über den Zerfall. Diesen Familienzerfall. Der grassiert doch überall. Auch in England. Da grassiert der besonders. Deswegen spielen wir diese englischen Stücke. Die sind so schnell, so wahnsinnig schnell, und da zerfällt immer die Familie, und Weihnachten ist doch ein Familienfest.
Castorf Das ist doch alles Quatsch, Ostermeier. Das weißte bloß noch nicht. Du hast deinen Höhepunkt doch schon lange hinter dir.
Ostermeier Herr Peymann, nun sagen Sie doch auch mal was. Weihnachten ist doch das Fest der Familie. Mit Liebe und so weiter. Das ist doch nicht falsch. Oder ist das falsch, Herr Peymann?
Peymann Das stimmt, Ostermeier. Weihnachten und Familie. Das paßt zusammen, und dann kommt die Liebe dazu.
Castorf Mir ist kalt. Hier zieht’s. Und dann diese Idee mit der Weihnachtsfeier. Nur wir drei. Das ist doch auch so eine Totgeburt.
Ostermeier Vielleicht laden wir Schlingensief noch dazu?
Peymann Wenn Schlingensief kommt, dann komme ich nicht.
Castorf Schlingensief bringt dann noch einen Haufen Asylanten oder Penner oder irgendsowas mit. Da ist dann die Bude schnell voll.
Peymann Ich dachte wir wären uns einig. Weihnachten nur wir drei. Als ein Zeichen. Wir sind die bedeutendsten Theatermacher Berlins und Deutschlands und wahrscheinlich der ganzen Welt. Und wir feiern gemeinsam Weihnachten und setzen uns so für den Weltfrieden ein.
Ostermeier Und für die Familie. Und für die Liebe auch.
Castorf Ich geh. Mir ist kalt.
Frank Castorf geht Richtung Osten ab.
Ostermeier Herr Castorf geht. Warum macht es das, Herr Peymann?
Peymann Castorf geht immer. Naturgemäß.
Ostermeier Aber dann sind wir jetzt nur noch zu zweit. Zwei Westler noch dazu. Da macht Weihnachten doch keinen Sinn mehr!
Peymann Weihnachten war schon immer sinnlos, Ostermeier. Die Familie ist auch sinnlos, sinnlos wie die Liebe und wie das Theater!
Ostermeier Halt! Nicht weiter, Herr Peymann! Nicht das Theater! Nicht das Theater sinnlos reden. Das macht mich ganz krank. Dann weine ich immer. Bitte, bitte beim Theater nicht sinnlos sagen!
Peymann Ich geh dann auch mal, Ostermeier.
Ostermeier Aber Herr Peymann, dann bleibe ich hier doch ganz allein zurück.
Peymann Am Ende sind wir immer allein, Ostermeier. Immer allein. Naturgemäß.
Peymann geht ein paar Schritte.
Peymann Schau, da kommt der Kanzler, Ostermeier. Er ist auch ganz allein. Wie wir alle. Immer allein. Naturgemäß.
Claus Peymann geht auf den Kanzler zu und schüttelt ihm die Hand.
Peymann Hallo, Schröder!
Schröder Tach, Peymann. Was machst Du denn Weihnachten so?
Beide richtung Kanzleramt ab. Ostemeier steht ganz allein am Ufer der Spree, schaut tief in den Osten und weint.
Quelle: »Die Tagespost«
- Bulgakow: Der Meister und Margarita
3.1.2005